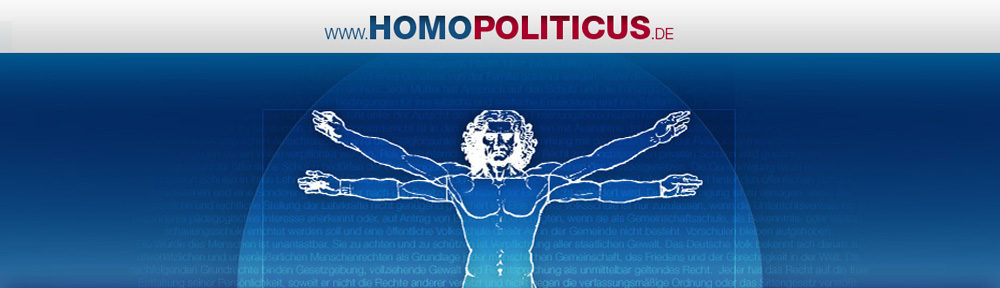Eigentlich scheint gerade, nicht mal einen Tag nach den Wahlen in Amerika, schon fast alles gesagt. Obwohl der Ausgang wohl insgesamt so absehbar war, überschlagen sich die deutschen Nachrichtenportale mit ihren Formulierungen. „Abrechnung mit Mr. Perfect“ heißt es bei Spiegel Online, „Denkzettel für Obama“ überschreibt WELT ONLINE einen Artikel. Hier soll sicher nicht darüber diskutiert werden, was die Wahlen und die Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus für die Präsidentschaft Obamas bedeuten, dafür sind andere sicher besser qualifiziert.
Doch spannend ist es schon, wie stark scheinbar die Meinung von Obama als amerikanischem Präsidenten in seinem Staat und in Europa auseinander geht. Zum einen trägt dazu sicherlich die Entwicklung des amerikanischen Parteiensystems bei, die in einem FAZ.net-Artikel von Klaus-Dieter Frankenberger hervorragend skizziert wird. Zum anderen schafft es aber die Obama-Administration trotz aller Vorschusslorbeeren nicht, ihre Politik erfolgreich zu verkaufen. Deutsche Analysten sind sich dabei relativ einig, dass die hohe Arbeitslosenquote und die wirtschaftlich angeschlagene Situation der Staaten viel mehr mit der Finanz- und Wirtschaftskrise zu tun hat, als offenbar Konsens der amerikanischen Bevölkerung ist. Mehr noch, es mehren sich in den Kommentarspalten die Stimmen, nach denen es Obama zu verdanken ist, dass die Lage nicht viel schlimmer ist.
Wieder einmal hat Obama die Wahlkampfmaschine angeworfen und sie virtuos bedienen lassen. Völlig ohne Registrierung konnte man sich mit einem beeindruckenden Werkzeug für Obama an den Telefonhörer klemmen und bei seinen Nachbarn, Freunden oder völlig Fremden für die Wahl der richtigen Abgeordneten, Senatoren und Gouverneure werben. Noch im Wahlkampf um die Präsidentschaft war das alles hinter den Zäunen von mybarackobama geschehen. Diese Zäune hat man nun eingerissen und lässt einfach alle, die sich engagieren wollen, mit für die gute Sache kämpfen.
Aber die fast zwei Jahre Präsidentschaft von Barack Obama zeigen ganz klar, dass Wahlkampf eben nicht alles ist. Die größte Herausforderung für einen Präsidenten scheint es heute vielmehr zu sein, seine Politik im täglichen Geschäft zu vermitteln. Die Finanzkrise und ihre Bekämpfung durch gigantische (im Nachhinein vielleicht sogar zu kleine ) Konjunkturspritzen ist gewissermaßen das Stuttgart-21 des Barack Obama. Mit geballter Kraft hat man die Reformen und Investments durchgesetzt, aber bei einem Teil der Bevölkerung blieb nur der Eindruck zurück, ihr Land sei nun endgültig sozialistisch geworden.
Und selbst bei weniger konservativen Wählerschichten, auf die Obama noch zur Präsidentschaftswahl bauen konnte, setzte immer mehr die Enttäuschung ein, weil eben doch nicht alle Wahlversprechen eingelöst werden konnten. Auch hier lässt sich wieder eine Parallele nach Schwaben ziehen, wo die Grünen noch das ein oder andere Problem mit ihren Versprechen für und wider den neuen Bahnhof bekommen könnten, wenn sie tatsächlich den Ministerpräsidenten stellen würden. Politikvermittlung, nicht Wahlkampf, scheint die Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu werden. Vielleicht ist es ja wieder Barack Obama, der nun aus dem Druck der unklaren Mehrheiten heraus, das Internet zum Werkzeug der Wahl werden lässt.