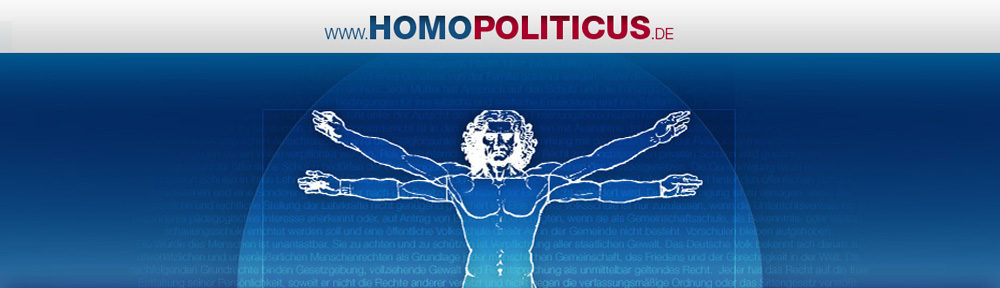Und schon ist es passiert, Karl-Theodor von und zu Guttenberg ist zweitbeliebtester Politiker Deutschlands und reiht sich damit direkt hinter jedermanns Liebling Merkel ein. Ein harter Schlag für Frank-Walter Steinmeier, der diesen Aufstieg Guttenbergs mit einem erneuten Verlust in der Gunst der Bürger erst ermöglichte.
 Es ist eine absurde Situation, dass CDU und CSU gleich zwei Politiker in ihren Reihen haben, mit deren Arbeit die Bevölkerung zufriedener ist als mit der des SPD-Spitzenkandidaten Steinmeier. Immerhin ist Steinmeier nicht nur Wahlkämpfer, sondern auch Außenminister in der Regierung Merkel. Das Amt gehört traditionell sicher nicht zu den am meisten kritisierten im Kabinett, bleibt aber auch gerade bei erfolgreicher Arbeit oft im Hintergrund. Nicht zuletzt trifft das auf Steinmeier zu, weil sich Angela Merkel geschickt als G8- und Europakanzlerin zu inszenieren versteht. Da bleibt für den Sozialdemokraten eigentlich nur noch das Händeschütteln und Geiselkrisen bewältigen.
Es ist eine absurde Situation, dass CDU und CSU gleich zwei Politiker in ihren Reihen haben, mit deren Arbeit die Bevölkerung zufriedener ist als mit der des SPD-Spitzenkandidaten Steinmeier. Immerhin ist Steinmeier nicht nur Wahlkämpfer, sondern auch Außenminister in der Regierung Merkel. Das Amt gehört traditionell sicher nicht zu den am meisten kritisierten im Kabinett, bleibt aber auch gerade bei erfolgreicher Arbeit oft im Hintergrund. Nicht zuletzt trifft das auf Steinmeier zu, weil sich Angela Merkel geschickt als G8- und Europakanzlerin zu inszenieren versteht. Da bleibt für den Sozialdemokraten eigentlich nur noch das Händeschütteln und Geiselkrisen bewältigen.
Harald Schoen spricht von einem Desinteresse der Bevölkerung für außenpolitische Themen, wenn diese nicht emotional präsentiert werden:„Viele Bürger schenken der Außenpolitik häufig keine allzu große Aufmerksamkeit. […] Innenpolitische Themen liegen für viele Bürger wesentlich näher. Daher gelten außenpolitische Fragen für die innenpolitische Meinungsbildung im allgemeinen und für Wahlverhalten im besonderen als nicht allzu bedeutsam.“ Zuletzt sei dies bei Gerhard Schröder anders gewesen: „Schröder gelang es offenbar, den Bürgern die Wichtigkeit des Irak-Themas vor Augen zu führen und sie dabei auch emotional anzusprechen.“ Emotionalität ist nicht gerade Steinmeiers Stärke.
Ganz anders kommt da der smarte Baron bei den Wählern an und verkauft sogar das vorsichtige Mahnen für eine Insolvenz wundersam publikumstauglich. Als scheinbar letzter Verfechter marktwirtschaftlicher Prinzipien führt er die SPD und ihre unglaubwürdigen Heilsversprechen für jedes angeschlagene Unternehmen an der langen Leine durch die Manege.
Unbestreitbar ist Guttenberg ein politisches Talent, wie es Deutschland schon seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Er hat das ihm zur Verfügung stehende halbe Jahr als Wirtschaftsminister für einen rasanten Aufstieg genutzt. Die meisten fachlichen Entscheidungen waren, so kurz vor der Bundestagswahl, schon getroffen und die Krisen von Opel und Arcandor boten Gelegenheiten, die ihm kaum günstiger zufallen konnten. Vor nicht mal einem halben Jahr war er noch Generalsekretär der CSU, weitere 4 Monate zuvor nur einfacher Bundestagsabgeordneter aus Franken. Und jetzt? Heute sprechen ihm bereits die ersten Gönner die Möglichkeit zu, eines Tages deutscher Bundeskanzler zu werden – die WELT sieht in ihm glatt einen kleinen Obama.
Dabei steht Guttenberg nicht wie Obama für einen inhaltlichen Wechsel, für eine Idee und deren Verwirklichung mit aller Kraft. Guttenberg repräsentiert vielmehr einen Charakterzug der CSU, den manche wohl als Wetterwendigkeit bezeichnen würden, andere als Flexibilität oder Anpassungsfähigkeit. Es kann niemanden verwundern, dass es der junge Baron war, der jüngst den Apologeten für eine schwarz-grüne Annäherung auch auf Bundesebene spielte.
Auf sonderbare Art und Weise wirkt der bayrische Baron dabei ein bisschen wie Gerhard Schröder, der als pragmatischer Politiker und gekonnter Dompteur der Medienlandschaft ebenfalls nicht für große Hoffnungen stand.
Es ist nur ein halber Obama, den unser Wirtschaftsminister darstellen kann. Ein Obama, von dem man Idealismus und Visionen einfach abzieht, der aber mit dem verbleibenden Charisma und seiner Überzeugungskraft immer noch alle überragt.
Aber wäre es nicht gerade die andere Seite Obamas, die Deutschland jetzt bräuchte?
Bilder: flickr Michael Panse MdL, ARD Deutschlandtrend