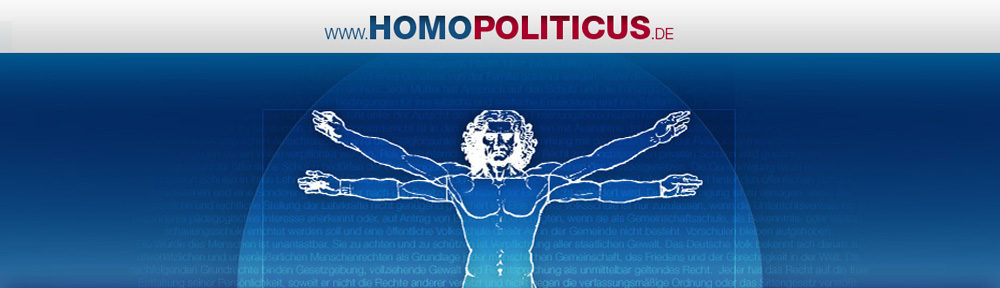John Kenneth Galbraith gilt als einer der bedeutendsten Ökonomen des vergangenen Jahrhunderts. Im Laufe seiner Karriere war er Berater zahlreicher amerikanischer Präsidenten – John F. Kennedy hörte ebenso auf seine Meinung wie der letzte demokratische Amtsinhaber, Bill Clinton – und beriet den wirtschaftlichen Aufbau Indiens als amerikanischer Botschafter.
Zentrum von Galbraiths Arbeit ist seine deutliche Kapitalismuskritik. Nach seiner Überzeugung produziert die Marktwirtschaft nicht nur privaten Reichtum, sondern auch zwangsläufig öffentliche Armut. Er prägte den Begriff der Überflussgesellschaft, mit dem er den Überfluss an privaten Gütern kritisiert, der für ihn ein Grund für mangelhafte öffentliche Infrastruktur- und Dienstleistungsvorsorge ist. Der Leiter der Wirtschaftsredaktion der Zeit, Uwe Jean Heuser, in einem Nachruf auf Galbraith:
Ende der fünfziger Jahre verfasste er Gesellschaft im Überfluss, seinen größten Erfolg. Galbraith warf den Vereinigten Staaten vor, sich gedankenlos der Spirale von immer mehr Konsum und immer mehr Umweltverpestung anheim zu geben. Die mächtigen Konzerne, die mit ihren Werbemilliarden neue Wünsche kreierten, waren ihm ein Dorn im Auge. Keiner könne sie mehr kontrollieren, schrieb er schon Jahrzehnte bevor die Kritik an den Multis modern wurde.
Galbraith fordert eine Beschränkung der totalen Marktherrschaft, einen umfassenden und leistungsstarken Sozialstaat. Die soziale Sicherheit eines Jeden solle von der Frage der Beschäftigung in der Produktion unabhängig sein.
Zahlreiche Kollegen, vor allem der Nobelpreisträger und Ökonom Paul A. Samuelson vom ‚Massachusetts Institue of Technology‘, warfen Galbraith zeitlebens vor, er sei mehr eine Medienpersönlichkeit als ein Ökonom:
Galbraith sei gar kein richtiger Ökonom, hat Paul Samuelson einmal der ZEIT gesagt, und Samuelson ist immerhin der Vater der modernen Wirtschaftstheorie. Er meinte damit, dass sich der Kollege früh von Modellen verabschiedete und ein politökonomischer Kommentator wurde. Galbraith war Professor in Harvard, ja, der Linksaußen seiner Fakultät, aber seine Impulse gab er von außen. In Bestsellern, im Fernsehen, auf Konferenzen.
Diese Tätigkeit als politökonomischer Kommentator nicht ernst genommen zu haben, das wiederum kann wohl niemand John Kenneth Galbraith vorwerfen. Noch 2004 mischte er sich fünfundneunzigjährig ein und veröffentlichte „The Economics of Innocent Fraud: Truth for Our Time“. Ein Essay, in dem sich Galbraith den Frust über neoliberale Politik der vergangenen 30 Jahre von der Seele schreibt.
Egal, womit er sich gerade befasste, Galbraith legte sich immer an. Herrschende Gedanken, die nicht mehr hinterfragt werden, forderten ihn zum Widerspruch heraus.
Weltwirtschaftskrise 1929
Die „Great Depression“ spielte eine wichtige Rolle in Galbraiths Leben, seine Begeisterung für Roosevelts Reaktion, den New Deal, behinderten gar seine Karriere. Dennoch war er sogar bereit, in der Roosevelt-Regierung Verantwortung zu übernehmen.
Eine geplatzte Spekulationsblase war es, die die Weltwirtschaftskrise auslöste. Zu hohe Aktienbewertungen, die sich nach leichtem Rückgang des Wirtschaftswachstums der USA plötzlich entluden und die frisch globalisierte Wirtschaft vieler Länder in den Ruin stürzte. Die Schuld war schnell der Globalisierung zugeschoben und so wurden internationale Anlagen zurück gezogen und die eigene Wirtschaft mit protektionistischen Maßnahmen abgeschottet.
Die Wirtschaftskrise traf Amerika hart. Ein Viertel aller Amerikaner war arbeitslos und die Löhne fielen um mehr als 50%. Der unkontrollierte Kapitalismus wurde als verantwortlich für diese Misere gesehen und das Misstrauen der Bevölkerung gegen Börsenspekulanten und Großkonzerne war groß. Der damals amtierende Präsident Herbert Hoover war wie sein Vorgänger Calvin Coolidge ein Anhänger der klassischen Wirtschaftstheorie gewesen und vertrat ein „Laissez-faire“ Prinzip der Selbstregulierung des Marktes. Viele Amerikaner aber empfanden Hoover zu schwach, forderten eine soziale Wende und so wurde 1932 Franklin Delano Roosevelt zu seinem Nachfolger gewählt.
Roosevelt verteilt die Karten neu
Der neu gewählte demokratische Präsident Roosevelt ging mit einem Paket von gebündelten Maßnahmen gegen die Massenarmut und die schwache Binnenkonjunktur vor. „New Deal“ bedeutet beim Kartenspiel eine Neuausgabe der Karten. Genau das versprach Roosevelt seinen Wählern, eine Beteiligung am Wohlstand.
Dazu ergriff er zahlreiche Maßnahmen, die vielfach von Keynes inspiriert waren – auch wenn ihnen keine ausgearbeitete Theorie zu Grunde lag. Die Einführung eines Sozialversicherungssystems, progressive Besteuerung und massive Arbeitszeitverkürzung gehörten ebenso dazu wie Eingriffe in das Lohn- und Preisgefüge und die Produktionskapazitäten. Nach wenigen Jahren erkannte die Regierung, dass der Weltmarkt für die Schaffung einer ausreichenden Nachfrage nötig war und bemühte sich, den Handel wieder zu liberalisieren.
Subprimekrise 2007/2008
Die Finanzkrise 2007/2008 erinnert fatal an die Weltwirtschaftskrise von 1929. Erneut eine Krise, die die Weltwirtschaft erschüttert. Erneut entstanden durch eine Spekulationsblase, diesmal bei den so genannten Subprime-Krediten. Dabei handelt es sich technisch gesehen um hochriskante Kredite, die in Amerika seit einigen Jahren in unverhältnismäßiger Zahl vergeben wurden. Diese Risiken wurden zu großen Zertifikaten gebündelt, was eine effektive Risikobewertung unmöglich machte. Dennoch wurde mit diesen Krediten weltweit Handel betrieben. Als nun jedoch die Kreditzinsen stiegen und die Schuldner ihre Kredite nicht mehr bedienen konnten, platzten weltweit die weit zu positiv bewerteten Anleihen.
Ulrich Schäfer, der Leiter der Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung zitiert dazu Galbraith:
Wer wissen will, wie schlimm die Finanzkrise werden kann, sollte bei John Kenneth Galbraith nachschlagen. Der amerikanische Ökonom hat vor fünf Jahrzehnten ein Buch geschrieben mit dem Titel „Der große Crash“. Auf 205 Seiten zeichnet Galbraith nach, wie die USA – und mit ihnen der Rest der Welt – 1929 in die Weltwirtschaftskrise taumelten.
Er erzählt eine Geschichte der Gier, des Überschwangs und der Überheblichkeit. Niemand sah die Gefahren, niemand sorgte sich, dass das ganze Finanzgebilde zusammenbrechen könnte. Alle glaubten, dass das amerikanische Wirtschaftsmodell nahezu perfekt ist.
So verhielt es sich auch bis zum 14. September 2008, als das Beben an der Wall Street begann.
Renaissance des New Deal?
Nicht nur das Phänomen der Krise scheint sich zu wiederholen, auch die Reaktionen deuten in eine ähnliche Richtung. Weltweit scheinen die Tage der deregulierenden Finanzpolitik dem Ende entgegen zu gehen.
Angenommen, Sie haben sich ein paar Wochen Urlaub auf einer einsamen Insel gegönnt, ohne Fernsehen, Internet und Zeitung. Nach ihrer Rückkehr erfahren Sie, was während Ihrer Auszeit so alles passiert ist: Die Wall Street ist beinahe zusammengebrochen. In den USA und in Europa werden im Schnellverfahren Banken verstaatlicht. China, zweitgrößter Gläubiger der USA, redet der Bush-Administration offen in die Finanzpolitik hinein, Venezuelas Staatschef Hugo Chávez nennt den amerikanischen Präsidenten jetzt »Genosse George«. Peer Steinbrück erklärt Steueroasen den Krieg, die Bankenmanager dieser Welt gehören seit Kurzem zur Achse des Bösen, und europäische Regierungen wollen mit einem neuen Bretton Woods den Finanzkapitalismus zähmen.
Wie schon 1932 wird mit Barack Obama wohl ein Demokrat einen Republikaner George W. Bush im Präsidentenamt beerben – und bereits jetzt ist wieder die Rede von einem „New New Deal“:
Im Wahlkampf gibt Obama den Verteidiger von Main Street gegen Wall Street, also der einfachen Bürger gegen die Bosse. Wie einst Franklin D. Roosevelt in der Depression der 30er Jahre wirbt er in der Krise mit einem „New Deal“, der die Balance zwischen Wirtschaft und Arbeitnehmern neu tariert. Millionen Jobs sollen durch alternative Energien entstehen.