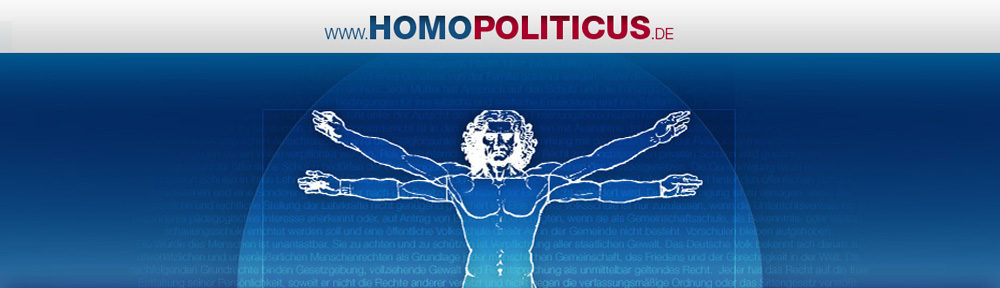Man stelle sich einmal vor, im letzten Bundestagswahlkampf hätte der Parteivorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, seinem Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück vier Wochen vor der Wahl jegliche Unterstützung entzogen und verlautbaren lassen: „Ich kümmere mich stattdessen um die Wiederwahl unserer direkt gewählten Abgeordneten“. Und niemand hätte sich darüber gewundert, nachdem Steinbrück doch die letzten 18 Monate damit zugebracht hatte, sich den Weg durch sämtliche Bevölkerungsgruppen zu pöbeln, jeden und jede PolitikerIn zu beleidigen und sich selbst als einzige Alternative aus dem politisch korrupten System der modernen Bundesrepublik zu erklären.
Ziemlich genau das passiert gerade in den Vereinigten Staaten. Der Präsidentschaftswahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump sprengt nicht nur für europäische Beobachter alles bisher Vorstellbare, auch ein großer Teil der Amerikaner aus Wählerschaft und Politik kann kaum glauben, was sie bis zum 8. November diesen Jahres gesehen haben und noch sehen werden. Und doch, wie Veit Medick in einem sehr klugen Stück für Spiegel Online schreibt:
Welch eine Farce! Mehr als ein Jahr lang hatten die Republikaner Zeit, um herauszufinden, dass dieser Kandidat eine Schande für die Partei und das ganze Land ist. Trump hat Behinderte nachgeäfft und Frauen erniedrigt, er hat Flüchtlinge mit giftigen Schlangen verglichen und in Mikrofone gerufen, dass er Demonstranten gerne ins Gesicht schlagen würde.
Es ist nicht nur eine Entwicklung erst dieses Wahlkampfs, in Wahrheit ist die amerikanische Politik in den letzten fast zwei Jahrzehnten in einem immer stärker werdenden Strudel aus Populismus, aus Selbstdarstellung, aus Konsensverweigerung und simpler Blockade wie gefangen. Medick schreibt:
Das Chaos, in dem Trump jetzt steckt, ist die gerechte Strafe für eine Partei, die in Wahrheit schon seit Jahren orientierungslos durch die Politik geistert. Trump symbolisiert die Krise des amerikanischen Konservatismus. Diese Krise wird nicht einfach verschwinden. Weder jetzt. Noch nach der Wahl.
Diese Krise betrifft vielleicht nicht nur den amerikanischen Konservatismus, vielleicht sogar die westliche geprägten Demokratien an sich. Und so haben wir auch Varianten des Donald Trump in unserer eigenen direkten Umgebung, auch wenn uns dieser Vergleich nicht immer gleich einfallen. Aber ob es Marine Le Pen oder die Kaczyński-Brüder sind, Victor Orban oder Jörg Haider, Nigel Farage oder Frauke Petry: mal links, mal rechts blinkender, heftigster Populismus ist längst auch in Europa eine beständige Größe.
In den Erklärungsversuchen für die Aufstiege von Populisten wie den genannten werden neben vielen klugen Ansätzen auch immer wieder drei angebracht, die mir nur bedingt schlüssig erscheinen.
Die Medien geben Populisten gerade erst ihre Bühne
Auch hier wieder hat mich ein Artikel, diesmal von Mark Pitzke, auf Spiegel Online, erst richtig aufmerksam gemacht. Übrigens: Deren Wahlberichterstattung kann man 2016 gar nicht genug loben. Doch zum Text:
Tragen doch gerade die US-Medien beträchtliche Mitschuld am unseligen Aufstieg Trumps. Seit den Achtzigerjahren, als er nicht viel mehr war als ein aufgeföhnter Möchtegern aus Queens, haben sie ihn hofiert und gehypt, als Schlagzeilen- und Auflagengarant. Trump ist ein Geschöpf der Medien, besser: ihre Missgeburt. Nun sehen sie sich zu schmerzhafter Introspektion gezwungen wie die ratlosen Eltern eines Amokläufers.
Auch in Amerika kein ganz neuer Vorwurf. Immer wieder kursierten Zahlen über das gewissermaßen kostenlose Werbebudget, das Donald Trump durch seine radikalen Äußerungen ergattert habe. Tatsächlich hat Trump so gut wie keine Werbeausgaben in seinen bisherigen Kampagnenmonaten angegeben; warum auch hätte er dieses Geld ausgeben sollen, wenn er einfach per Twitter oder vom Wahlkampfpodium neue Kontroversen anstoßen und so die gleiche Wirkung erzielen kann.
An dem Punkt ist ja etwas Wahres dran. Natürlich tragen die Medien keine Alleinschuld, selbstverständlich ist mediale Aufmerksamkeit an sich noch kein Garant für politischen Erfolg. Aber das Extreme macht immer mehr Schlagzeilen als das Moderate, Beleidigungen bringen mehr Auflage als Differenziertheit. Gleichzeitig hinkt jedenfalls der zweite Halbsatz auch wieder. Denn die Berichterstattung in den letzten beiden Wahlkämpfen hat auch den Hoffnungs und Change-Slogan von Barack Obama weit getragen. In der Medienkritik, der professionellen wie amateurhaften, ist das Grundproblem ja schon viel länger bekannt. Nicht erst in der Politik wird Selektivität beanstandet, auch in der Betrachtung von Welt und eigener Gesellschaft geht uns doch allen oft genug der Blick auf das Gute, Motivierende, Positive verloren. Es ist nicht nur den Medien, sondern auch uns als KonsumentInnen eigen, dass Sensationen sich stärker einbrennen als Bedächtiges. Daher ist es vielleicht richtiger zu sagen, dass Populismus nicht die „Missgeburt der Medien“ ist, sondern mindestens genauso unsere eigene. Und damit zu uns selbst:
Reife Gesellschaften sind nicht rechts
Es wird immer Extreme an den Rändern geben: Aus deutschem Blickwinkel mag man diesen Satz erstmal zu leicht abtun, schließlich waren unsere politischen Extreme noch bis vor wenigen Jahren verschwindend klein. Die NPD und vereinzelt die Republikaner waren die einzig wirklich extremen Parteien der Bundesrepublik und vereinten zusammen kaum 5 Prozent der Wahlbevölkerung auf sich. In anderen Ländern jedoch und in Deutschland auch seit der Entstehung der AfD bewegen wir uns stärker in die Richtung der 11 Prozent, die nach einem starken Führer rufen oder gar der bis zu 25 Prozent Ausländerfeindlichkeit; beides Zahlen, die die Friedrich-Ebert-Stiftung regelmäßig misst.
Dennoch gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen 11-25 Prozent Extremen und den mehr als 50 Prozent, die für Donald Trump oder den Brexit stimmen (würden). Es muss etwas Größeres als latenter Rassismus und Autoritarismus sein, der das Aufstreben des Populismus in westlichen Demokratien begründet.
Nun mag man auch über die möglichen statistischen Fehler der Ebert-Studie spekulieren und detaillierte Untersuchungen über die Wählerschaft von Brexit-Befürworten und Trump-Anhängern stehen noch aus. Vielleicht hilft da ein Blick weg von den großen Zahlen, hin zu der Wählerschaft der AfD, über die in den letzten Monaten in Deutschland viel geredet worden ist. Denn dort sind mitnichten die Montagsmärschler und Volksverräter-Lautsprecher in der Mehrheit. Stattdessen reicht die Wählerschaft weit hinein in das, was man früher bürgerliches Klientel genannt hat. In meiner strukturkonservativen Heimat Mittelhessen, die sogar das an sich schon traditionell konservativ-agressive Hessen überflügelt – wir entsenden den Hetzer Hans-Jürgen Irmer in den Hessischen Landtag – hier gibt es eine Menge AfD-Unterstützer. Von denen distanzieren sich zwar auch erfreulich viele von den eindeutig rassistischen Äußerungen eines Bernd Höcke (sic!). Doch ohne diese klar braunen Anwandlungen, eine blaue Wählerschaft gäbe es hier in großem Maße.
Die Gründe für diese Sympathie sind vermutlich weit vielschichtiger, als man das vermutet. Klar war die Flüchtlingskrise ein Auslöser für den Aufstieg der AfD bei den letzten Wahlen und auch in den bundesweiten Umfragen. Aber nicht zu unterschätzen dürfte der Eindruck sein, dass man nun endlich eine Partei habe, die man mit Anstand wählen könne. Die Motive der einzelnen Sympathisanten müssen dafür nicht ausschließlich oder überhaupt die Flüchtlinge sein.
Und auch der zweite Ansatz, der der zumindest gefühlt ökonomisch Abgehängten, wird wieder nur eine Teilmenge der AfD-Unterstützer betreffen. Wieder im Blick auf meine Heimat lässt sich simpel feststellen, dass wir in einem wohlhabenden, kleinbürgerlichen Umfeld aufgewachsen sind, in einer hochindustrialisierten Wirtschaftsumgebung voller „Hidden Champions“ und Eigenheime mit Gartenhaus. Selbst die Kurzarbeit während der Finanzkrise hat hier kaum Existenzen bedroht. Und doch steigt die Unzufriedenheit mit der bestehenden Politik.
In beiden oben erwähnten Erklärungen geht man von einem beständigen Interesse an Politik aus, das mit der Zeit enttäuscht worden ist. Vertrauen, das noch vor 30 Jahren in die jeweilige politische Heimat gesetzt worden ist, sei verschwunden. Aber ist, wie im letzten Satz des vorigen Absatz geschrieben, die Unzufriedenheit mit der bestehenden Politik wirklich gestiegen? Oder ist nicht eher das Interesse der BürgerInnen an der Politik gestiegen, wird nicht der Informationsfluss heute bewusster zur Kenntnis genommen, stärker analysiert und begutachtet?
Blick zurück nach Amerika: Haben die AmerikanerInnen wirklich unter Kennedy oder Reagan, unter Carter oder Clinton aktiv am politischen Diskurs teilgenommen? Haben sie nicht vielleicht erst in den letzten 10, 15 oder 20 Jahre ihr Interesse an und die Fähigkeit sich mit Politik auseinanderzusetzen in breiter Basis gefunden? Und bei uns, sind dort nicht unter Brandt und Kohl die politischen Grundlinien zwar wohlwollend zur Kenntnis genommen worden, aber nie im Detail hinterfragt? Passen nicht auch die Widerstände gegen Gerhard Schröders Agenda 2010 und die andauernden Amtszeiten Angela Merkels ebenfalls in ein solches Erklärungsmuster?
Kurzum: Verortet man die politische Entwicklung einer Bevölkerung in der Skala eines Menschenlebens: Sind wir schon längst Erwachsene, lange geübt in der Auseinandersetzung mit Politik, oder nicht doch gerade erst in der Pubertät, mit allen erfreulichen und unerfreulichen Erfahrungen, die damit einher gehen?
Mit Wahlkampf ist Populismus nicht beizukommen
Bei manch Wahlanalysen nach dem erneuten AfD-Erfolg sehen wir die gleiche Ratlosigkeit wie die derzeitige der Amerikanischen Demokraten. Wir alle, die wir auf der „guten“ Seite der Politik zu stehen glaubenden, können nicht verstehen, wie es soweit kommen konnte, trotz Skandalen über Skandalen. Wir haben, so versichern wir uns gern selbst, doch alles getan, was in unserer Macht stand, um die ewig einfachen Antworten, die doch nie eine Frage lösen, zu bekämpfen. Und für jeden einzelnen Wahlkämpfer gilt das ebenso sicher wie für die KandidatInnen. Natürlich betreiben wir alle Wahlkampf mit Herzblut und wohl kaum ist mal einE KampagnenmanagerIn zwei Wochen vor der Wahl durch ihr Hauptquartier gelaufen und hat einen Haufen schlafende oder gelangweilte HelferInnen gesehen. Alle haben wir die Botschaft destilliert und dann unters Volk zu bringen versucht, sind doch unsere Argumente noch dazu die klar besseren als die der Gegenseite, wie wir uns immer wieder versichern.
Aber wir müssen eben auch die Perspektive einmal umkehren und uns ganz simple Fragen stellen: Wie viel Prozent der Wahlberechtigten haben wir eigentlich in diesem Wahlkampf erreicht? Die Zahlen werden schon nicht berauschend sein, wenn wir von Erreichen im Sinne eines einfachen Kontaktes, ob per Plakat, Werbespot oder Wahlkampfstand reden. Ein wie großer Anteil hat bewusst hingesehen oder hingehört, wenn auch nur für einen Augenblick? Dann stellt man sich noch die Frage, wie effektiv unsere Kontakte waren, bei wie vielen Wahlberechtigten wir auch nur die kleinste Sekunde des Nachdenkens über unsere Positionen erzielen konnten, ein wirkliches Auseinandersetzen mit unseren Argumenten, dann müsste man vermutlich einfach weinen.
Lange Jahre war das in Amerika anders. Die Wahlkampfbudgets im US-Präsidentschaftswahlkampf übertreffen die unseren um mindestens den Faktor 50, die Wahlkampfspots laufen gerade in den Swing States und während der heißen Wahlkampfphase fast rund um die Uhr in TV und Radio. Freiwillige besuchen beachtliche Anteile der Wahlberechtigten an der eigenen Tür und die Online-Kampagnen sind vom Allerfeinsten. Wie weit wir davon weg sind, lässt sich an den neuesten Wahlkampfentdeckungen der letzten bundesdeutschen Wahlkämpfe leicht erkennen: Mal probieren wir Blogs, dann ist es Twitter und zuletzt gibt es erste Tests mit dem Haustürwahlkampf. Nur Experimente, kleine Testballons, die wir mit geringem Aufwand mal ausprobieren, damit wir etwas von Barack Obama gelernt haben. In die Masse ist davon nichts je gegangen, nicht in dem Aufwand, den wir dort hinein gesteckt haben und erst recht nich im Sinne einer Massenwirkung. Und sieht man vom dem scheinbar urdeutschen Plakatwald ab, gilt die eingeschränkte Wirkung nicht auch für nahezu alle anderen Wahlkampfmaßnahmen wie Themenabende und Stände in der Fußgängerzone?
Vielleicht ist das sogar gut, dass wir in Deutschland nie auf diese immensen Wahlkampfbudgets der USA aufgesprungen sind. Denn dort sehen wir dieses Jahr immens deutlicher, im Kleinen aber schon bei den letzten Wahlkämpfen, dass sich Aufmerksamkeit nicht unbedingt kaufen lässt. Hillary Clinton wird bis zum Wahltag mehr als 1 Milliarde Dollar ausgegeben haben, und hat Donald Trump, den vermutlich schlechtesten Kandidaten aller Zeiten, trotzdem nur mit höchster Not auf Distanz halten können. Das ihr entgegen gebrachte Misstrauen und der ein oder andere Aufreger haben völlig gereicht, dieses Budget ins Leere laufen zu lassen. An mangelndem Interesse kann das kaum liegen, denn man muss sich mit jemandem zumindest kurz beschäftigt haben, um ihn so zu verabscheuen, wie Hillary Clinton das erfahren muss. Rückschlüsse lassen sich daraus nur zwei ziehen – und beide sind ähnlich herausfordernd:
- Waren entweder die Budgets noch immer zu klein oder wurden in falschen Medien eingesetzt?
- Oder wurden die Budgets verschleudert, weil die inhaltliche Ansprache nie durchgedrungen ist?
Es wäre jetzt an der Zeit, sich genauer mit diesen Fragen zu beschäftigen. Denn ob in den USA oder hier in Europa, es muss Aufgabe und eigenes Anliegen der Politik sein, wieder endlich mal eine Mehrzahl der Wahlberechtigten vor allem inhaltlich zu erreichen. Wenn man dann mit seinen Argumenten nicht überzeugen kann, ist das völlig in Ordnung. Aber die Diskussion gar nicht zu erreichen, das ist der wahre Antrieb für Populismus.
Disclaimer: Der Autor ist Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen und versucht sich als Dienstleister der Hessischen Grünen schon seit Jahren an effektiverem (Online-)Wahlkampf.
Disclaimer 2: Auf Grund des Stichworts AfD und der damit nicht auszuschließenden Trollflut, sind die Kommentare unter diesem Artikel gesperrt. Über Beleidigungen und andere hilfreiche Hinweise freue ich mich auf Twitter unter @chrstnjng.