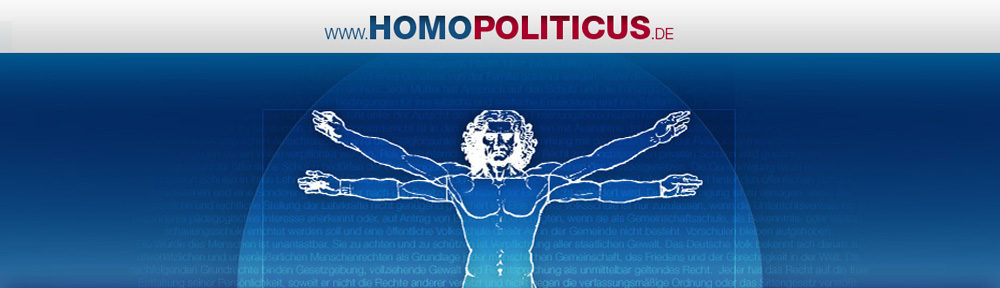Seit seiner Vereidigung am Dienstag ist Barack Obama der 44. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. In den kommenden Jahren hat er viele Aufgaben zu bewältigen, bereits vor seiner Vereidigung hat sich gezeigt, dass Obama das Amt in schwierigen Zeiten übernehmen wird. Viele feiern ihn trotzdem als Retter des scheinbar verloren gegangen amerikanischen Traumes. Doch bereits mit seiner Antrittsrede und seinen Handlungen in den ersten Tagen zeigte Obama, dass er in den kommenden Monaten einen straffen Kurs fahren möchte. Er betont, dass er dabei der Präsident aller Amerikaner und auch aller Menschen in der Welt sein möchte. Und auch außerhalb von Amerika wird der neue Präsident frenetisch gefeiert. Doch zeigt sich bereits jetzt, dass Obama nicht nur auf Kuschelkurs mit Europa aus sein wird. Was also bringt die Wahl Obamas für uns?
Schon in seiner Antrittsrede am Dienstag vor dem Capitol in Washington machte Barack Obama deutlich, dass er einen Bruch mit der Politik seines Vorgängers George W. Bush vollziehen will und kündigte einen Neuanfang Amerikas an. Dass dieser Neuanfang auch Veränderungen für die Welt bedeuten wird, zeigt sich bereits jetzt. Obama wird vor allem in der Wirtschafts-, Klima- und Außenpolitik Entscheidungen fällen, die Europa direkt betreffen werden. Barack Obama versprach der Welt ein neues Amerika, das allen zuhören und wieder Führungskraft zeigen werde. Der islamischen Welt sagte er das Bemühen um neue Beziehungen im Geist des beiderseitigen Interesses und des gegenseitigen Respekts zu. Er werde aber auch alles tun, um Amerika vor der terroristischen Bedrohung zu schützen. Doch machte Obama gleichermaßen deutlich, dass er um diese Ziele umsetzen zu können die Welt und Europa auch fordern werde.
Forderung nach einem stärkeren militärischen Engagement der weltweiten Partner
Obama hat angekündigt, die rund 140.000 im Irak stationierten US-Soldaten innerhalb der nächsten 16 Monate weitgehend abzuziehen. Die höchste Priorität hat bis auf weiteres der so genannte „Kampf gegen den Terror“ in Afghanistan. Dort will er die US-Truppen wiederum von derzeit 32.000 auf 62.000 aufstocken.
„Wir werden damit beginnen, den Irak verantwortungsvoll seinen Bürgern zu überlassen und einen schwer erarbeiteten Frieden in Afghanistan zu erwirken“, sagte er bei seiner Antrittsrede am Dienstag in Washington.
In diesem Zusammenhang fordert Barack Obama bereits seit längerem ein größeres Engagement der NATO-Partner am Hindukusch. Auch Deutschland hat er während seines Wahlkampfes im letzten Jahr bereits mehrfach offen dazu aufgerufen, sich in der Krisenregion noch stärker zu beteiligen. Viele sehen in diesen Forderungen bereits die erste Bewährungsprobe für Barack Obamas Überzeugungskraft, da erwartet wird, dass er mit dieser Forderung im April zum NATO-Gipfel nach Baden-Baden anreisen wird. Der Aufenthalt stellt gleichzeitig seinen ersten Deutschland-Besuch als US-Präsident dar und es kann erwartet werden, dass er mit seinen Forderungen hierzulande nicht nur auf offene Ohren stoßen wird
Der Nahostkonflikt als erste direkte Bewährungsprobe
Neben allen weiteren Problemen wird Barack Obama direkt nach seiner Amtseinführung auch mit dem Naheostkonflikt konfrontiert. Im Wahlkampf hatte er versprochen, dass die USA unter seiner Führung mehr Druck auf Israel und die Palästinenser ausüben würden, sich zu einigen. Deshalb war eine seiner ersten Handlungen im nun von ihm benutzten „Oval Office“, wie versprochen der Griff zum Telefonhörer. So sprach er bereits am Mittwochmorgen mit dem israelischen Regierungschef Ehud Olmert, Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, Ägyptens Präsident Husni Mubarak und König Abdullah II. von Jordanien.
Schließung des Gefangenenlagers auf Guantanamo
Ebenfalls hatte Barack Obama versprochen das umstrittene US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba so schnell wie möglich zu schließen. Und tatsächlich war die Aussetzung der Verfahren im Gefangenenlager eine seiner ersten Amtshandlungen als US-Präsident. In diesem Zusammenhang will er Folter und folterähnliche Methoden wie etwa simuliertes Ertrinken („Waterboarding“), die unter der Regierung Bush bei Verhören von Terrorverdächtigen geduldet waren, ausnahmslos verbieten. Was wiederum mit den noch 250 verbliebenen Insassen auf Guantanamo geschieht ist noch nicht klar. Aber Obama hat bereits angekündigt, dass die weltweite Staatengemeinschaft aufgefordert sei, ehemalige Häftlinge aufzunehmen. Auch in Deutschland wird das Thema deshalb bereits seit einiger Zeit diskutiert. Hier erwartet Obama ebenfalls die Unterstützung Deutschlands.
Stärkere Gemeinsamkeiten beim Klimaschutz
Größere Gemeinsamkeiten weist die deutsch-amerikanische Beziehung vor allem beim Thema Klimaschutz auf. Barack Obama will die Ablehnerrolle der USA bei der Umsetzung des Kyotoprotokolls beenden und strebt eine Führungsrolle bei den Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen an. Sein Ziel ist es dabei den Ausstoß von Treibhausgasen in den USA bis 2020 auf das Niveau von 1990 zu senken. Des Weiteren wünscht er sich eine Übernahme des europäischen Emissionshandelsmodells. In den nächsten zehn Jahren hat Barack Obama vor, mit Investitionen von 150 Milliarden Dollar einen ökologischen Umbau der US-amerikanischen Wirtschaft voranzutreiben. So betonte er in seiner Antrittsrede am Dienstag: „Wir werden die Sonne, den Wind und die Erde nutzen, um unsere Autos zu betanken und unsere Fabriken zu betreiben“.
Im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik kann deshalb ebenfalls einer der zentralen Paradigmenwechsel der US-Politik durch die Amtseinführung Obamas gesehen werden. In diesem Gebiet sind derzeit auch die größten Harmonien zwischen den Europa und den USA zu erwarten.
Wirtschaftliche Veränderungen
Besonders den Kampf gegen die Wirtschaftskrise hat sich Obama auf die Fahnen geschrieben, da daran maßgeblich über den Erfolg seiner Arbeit entschieden wird. Aus diesem Grund will er bereits in den ersten Wochen seiner Amtszeit mit einem staatlichen Konjunkturpaket von 825 Milliarden Dollar gegensteuern. Des Weiteren möchte Barack Obama angeblich beim nächsten G20-Treffen im April in London Pläne für eine neue Finanzaufsicht präsentieren. In diesem Zusammenhang soll geregelt werden, dass Banken, die Staatshilfen bekommen haben, von der Notenbank strenger überwacht werden. Ebenso hat Obama bereits im Wahlkampf deutlich gemacht, dass er nicht gegen Freihandelsverträge ist, aber durch Mindestbedingungen den Schutz für die Arbeiter erhöhen möchte.
Auch Einschnitte in seiner eigenen Administration
Doch um Kritiker zu besänftigen hat Obama nicht nur Forderungen nach außen gestellt, sondern auch starke Einschnitte nach innen angekündigt. So machte er bereits zwei Tage nach seiner Amtseinführung deutlich, dass es eine seiner Hauptaufgaben in Washington werde, den Lobbyismus effektiv zu bekämpfen. Die Politik solle wieder zurück aus den Hinterzimmern in die öffentlichen Arenen.
Des Weiteren verfügte Obama, dass Gehälter von Mitarbeitern des Weißen Hauses über 100.000 Dollar eingefroren werden. „Amerikanische Familien müssen den Gürtel enger schnallen, also muss Washington das auch“, sagte er.
Gespanntes Warten auf den Wandel
Insgesamt zeigt sich also, dass die ganze Welt gespannt darauf ist, ob Barack Obama die ihm zugeschriebene Rolle des „Brückenbauers“ erfüllen kann. Bereits in den ersten Tagen seiner Amtszeit hat er gezeigt, dass er einen Neuanfang wagen und mit der Politik seines Vorgängers brechen möchte. Dies wird in Europa positiv aufgenommen. Lange vergeblich mit den USA diskutierte Politikinhalte wie die Klima- und Umweltpolitik scheinen plötzlich verhandelbar. Und auch das weltweit kritisierte Gefangenenlager Guantanamo-Bay wird Obama sehr zu Freude des Großteils der Weltengemeinschaft schließen.
Doch trotzdem hat Obama schon im Wahlkampf keinen Hehl daraus gemacht, dass er auch – gerade in Fragen der Außenpolitik – Forderungen stellen wird. So ist es nur noch eine Frage der Zeit bis er nun offiziell als Präsident der Vereinigten Staaten an die Tür der deutschen Bundesregierung klopfen und ein größeres Engagement in Afghanistan fordern wird. Es ist zu erwarten, dass dies den ersten Dämpfer der Obama-Euphorie in Deutschland bedeuten wird. Abzuwarten bleibt aber wie weit die Forderungen Barack Obamas an die Staatengemeinschaft in anderen Bereichen aussehen werden. Wird er einen harten Kurs fahren oder erst einmal darauf aus sein, ehemalige Risse in den Verbindungen zwischen den Partnern zu glätten? So oder so steht seine Politik unter dem Zeichen des Wandels.
Dieser Artikel erschien zuerst bei idea.de
Foto: Flickr 12thStDavid