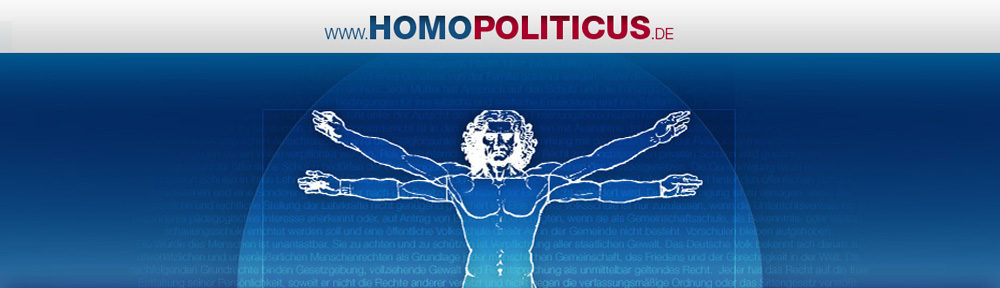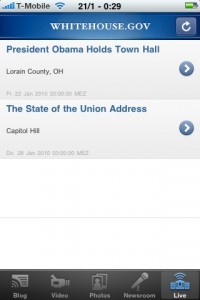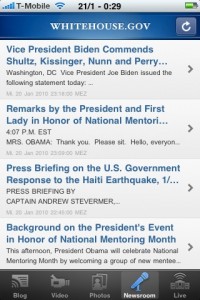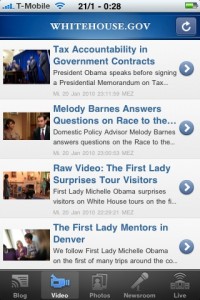von Axel Bruns
Barack Obamas Kampagne für Primaries und Präsidentschaft wird weithin als Sternstunde der Nutzung sozialer Medien im Wahlkampf angesehen – auch wenn Obamas Team selbst natürlich so einiges von Howard Deans Primary-Kampagne 2004 abgeschaut hat. Ein gemeinsamer Faktor in beiden Kampagnen ist dabei, daß sich sowohl Dean als auch Obama als Erneuerer und Underdogs (sogar in ihrer eigenen Partei) präsentieren konnten. Soziale Medien erlaubten es Obama, zu einer Zeit Unterstützer zu werben, in der die meisten Kommentatoren für seine Kampagne noch keine großen Chancen sahen, und dann mit Hilfe dieser ersten Fans auf my.barackobama.com eine breite Massenbewegung aufzubauen.
Auch andere Politiker – übrigens sowohl im konservativen wie auch progressiven Lager – haben sich mittlerweile auf diese Weise der sozialen medien bedient; wie auch Obama hat z.B. der britische Tory-Herausforderer David Cameron über sein Videoblog Webcameron eine Langzeitstrategie verfolgt, die darauf gerichtet war, ihn als verläßliche und nicht allzu extrem neokonservative Alternative zu Gordon Brown zu präsentieren. Hier in Australien, wo ich arbeite, spulte die Labor Party im Wahljahr 2007 eine äußerst erfolgreiche Kampagne ab, in der besonders auch die Webpräsenz von Oppositionsführer Kevin Rudd auf seiner Kampagnenwebseite Kevin07 eine wichtige Rolle spielte – nicht zuletzt auch dadurch, daß sie die erzkonservative Regierung unter John Howard dazu nötigte, auf YouTube selbst einige (eher hilflos anmutende) Web-2.0-Experimente zu machen. Diese Videos – eines machte den Faux Pas, ein Video mit den Worten „Good Morning“ zu beginnen, ein anderes verkündete eine recht unmotivierte $500.000-Initiative zur Schützung von Orang-Utans in Indonesien – trugen nur weiter dazu bei, Howard als steif und senil hinzustellen.
Derlei Präzedenzfälle legen natürlich die Frage nahe, ob soziale Medien immer eher ein Werkzeug der Herausforderer sein werden, oder wie weit auch amtierende Landesväter und -mütter aus ihnen Nutzen ziehen können. (Zudem muß übrigens auch darauf hingewiesen werden, daß sich die recht überschaubaren Zwei-Lager-Systeme in den USA, Großbritannien und Australien nicht unbedingt direkt mit der besonders derzeit deutlich komplexeren Gemengelage zwischen den verschiedenen Ex- und Möchtegern-Volksparteien in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Staaten vergleichen lassen.) Was sich dabei in den verschiedenen für den Wahlkampf benutzten Web-2.0-Plattformen selbst tut, ist dabei womöglich nicht einmal immer ganz so wichtig wie die Tatsache an sich, daß diese Plattformen überhaupt genutzt werden: zumindestens für die Underdogs und Herausforderer mag die Nutzung alleine schon Grund genug sein, sich dem Amtsinhaber als innovativ und zukunftsfreundlich gegenüberzustellen; die amtierende Regierung selbst mag dagegen herausstellen wollen, daß sie erfahren und verläßlich ist und eben nicht jedem Trend hinterherläuft.
Andererseits wird natürlich heutzutage besonders den Inkumbenten ein völliges Fehlen jeglicher Onlinepräsenz, oder eine eher langweilig gestaltete Webseite, als Zeichen von Überalterung und Behäbigkeit angerechnet werden. Mit anderen Worten: eine zu aggressive Onlinestrategie mag dem Amtsinhaber mehr Ärger als Freude bereiten; eine zu laue Präsenz aber ist Wasser auf die Mühlen der Opposition, weil sie alle Vorurteile gegen ‚die da oben‘ bestätigt – was tun?
Es ist wohl kaum zu erwarten, daß eine wirklich überzeugende Antwort auf diese Frage aus den Niederungen deutscher Landtagswahlkämpfe erwächst; wir werden wohl bis 2012 warten müssen, wenn Barack Obama zur Wiederwahl gegen das republikanische Dream Team aus Sarah Palin und Glenn Beck antritt und dabei seine geschätzten 13 Millionen Unterstützer auf my.barackobama.com zu reaktivieren versucht. In NRW etwa ist der in letzter Zeit ja arg gebeutelte Ministerpräsident Jürgen Rüttgers mit Sicherheit nicht in auch nur annähernd vergleichbarer Position – aber sehen wir uns dennoch einmal an, was die Landes-CDU online so anzubieten hat.

Zunächst einmal fällt dabei (über das „italienische Eisdiele“-Logo hinaus) auf der NRW für Rüttgers-Webseite auf, daß – wie branchenüblich – ein CDU-Branding völlig fehlt; die Webseite wird mit anderen Worten für Unterstützung für Rüttgers als Person, nicht als CDU-Politiker. Dieser Eindruck wird allerdings recht schnell dadurch untergraben, daß einer der letzten Beiträge ein großflächiges Bild des Wahlkampfplakats mitsamt CDU-Logo beinhaltet, und in einem zweiten das Logo nur durch CDU-Generalsekretär Andreas Krautscheids Körper verdeckt wird. Ohnehin stellt sich hier natürlich die Frage, ob es in NRW überhaupt noch einen Wähler geben mag, der Rüttgers nicht automatisch mit der CDU in Verbindung bringen würde. Aus der Opposition mag es ja sinnvoll sein, die Spitzenkandidaten als Personen statt als Parteipolitiker herauszustellen, um so Wechselwähler zu werden, die zwar eigentlich eine bestimmte Partei nicht wählen würden, aber von der Person überzeugt sind – ob das aber bei einem amtierenden Ministerpräsidenten auch funktionieren kann, muß doch deutlich bezweifelt werden.
Darüberhinaus ist es das erklärte Ziel von NRW für Rüttgers, als Unterstützerportal für den Kandidaten zu fungieren; viel davon zu sehen ist auf Anhieb allerdings nicht. Die auf der Hauptseite zu sehenden Inhalte sind allesamt offizieller Natur und lesen sich nicht sonderlich anders als Pressemitteilungen. Die Kurzstatements von Unterstützern („Ich unterstütze Jürgen Rüttgers, weil er Wirtschaft und Soziales vereint!“) weisen durch nichts darauf hin, daß sie einer anderen Quelle entstammen als den Tastaturen eines PR-Büros – zwar sind sie mit Fotos ihrer angeblichen Urheber versehen, aber es gibt keine Möglichkeit für Besucher, sich zum Profil der Autoren durchzuklicken und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Als möglicher Unterstützer müßte ich erst mein eigenes Profil erstellen, bevor ich sehen kann, ob es im eigentlichen Community-Teil der Webseite interessanter zugeht als auf einem Kaffeekränzchen der Jungen Union.
Wie die Webseite auf diese Weise erfolgreich Unterstützer werben und diese dazu ermuntern will, für Jürgen Rüttgers Wahlkampf zu machen, bleibt daher eher unklar. Eine echte Nutzung sozialer Medien für virales Marketing sieht deutlich anders aus: hier werden den Nutzern freigebig und ohne große Beschränkungen vielfältige Materialien zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe sie auf eigene Faust für bestimmte Produkte oder Parteien Stimmung machen können. Zwar geht dabei notwendigerweise einiges an ‚Message Control‘ verloren, und die eigenen Materialien mögen mitunter auch für Parodien zweckentfremdet werden – einer der besten YouTube-Spots im australischen Wahlkampf 2007 war z.B. ein Video, das Kevin Rudd in Anspielung auf seine Mandarin-Sprachkenntnisse im Stile eines chinesischen Propagandafilms präsentierte –, aber auch hier gilt meist das alte Maxim „any publicity is good publicity“.
Nicht zuletzt aber bedeutet die Nutzung sozialer Medien im Wahlkampf auch ein recht transparentes Herangehen an die Wähler: potentielle Unterstützer können zumeist nur dann in größerer Zahl geworben werden, wenn sie intelligent angesprochen werden und ihnen einiges an Klarheit darüber gegeben wird, wen und was sie da nun eigentlich genau unterstützen werden. Kontroverse Themen und Programmpunkte müssen dabei offen diskutiert werden können – nicht unbedingt immer nur mit den Spitzenkandidaten, sondern auch mit anderen Unterstützern und den Mitgliedern des Kampa-Teams. Besonders hier mangelt es bei NRW für Rüttgers doch erheblich: die Urheber der Artikel auf der Hauptseite etwa bleiben allesamt anonym, und auch wenn es eine Kommentarfunktion gibt, ist sie offenbar noch nie benutzt worden (was doch recht unwahrscheinlich klingt). Sonderlich sozial ist diese Onlineplattform also nicht gerade.
Aber das ist am Ende vielleicht auch nicht der Zweck der Übung. Wirkliche Transparenz, wirkliche Diskussion ist wohl eher angebracht für diejenigen (Oppositions-)Parteien, die die Gunst der Wähler erst noch erwerben wollen und müssen, und weniger für solche, die sich in erster Linie ängstigen müssen, diese Gunst so langsam zu verlieren. NRW für Rüttgers sollte daher wohl vor allem als Defensivmaßnahme gesehen werden, deren Existenz alleine schon halbwegs als Argument hinhalten kann, daß auch der Amtsinhaber ‚Web 2.0 macht‘, die aber deshalb noch lange nicht soviel Spielraum erhält, wie nötig wäre, um wirklich mit konsultativen Politikmodellen zu experimentieren.
Die Webseite demonstriert also vor allem die Risikoscheue, die Inkumbenz mit sich bringt. Rüttgers hat wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren – ein warum auch immer aus dem Ruder laufendes Onlineexperiment könnte durchaus deutliche negative Folgen haben, eine eher lahme, allzu vorsichtige Onlinepräsenz dagegen macht wenigstens nicht die Pferde scheu, auch wenn sie nicht wirklich dazu beiträgt, neue Wähler zu werben. Das heißt im Umkehrschluß freilich nicht, daß die Websiten der Oppositionsparteien notwendigerweise die sozialen Medien effektiver nutzen; auch hier gibt es Einiges an Defiziten, und dabei sehr viel weniger gute Gründe, ein wenig Risiko einzugehen, um neue Unterstützer zu werben.
Am Wahlabend wird sich zeigen, ob die hier erkennbare CDU-Strategie, den Wählerschwund weitestmöglich zu begrenzen, statt über eine aggressivere Kampagne mit Hilfe der sozialen Medien neue Wähler zu werben, erfolgreich gewesen ist. Nun ist Jürgen Rüttgers natürlich ohnehin kein David Cameron oder Barack Obama – aber gerade weil Landeswahlkämpfe wie der in NRW so überaus durchschnittlicher sind als die großen Kämpfe um Präsidenten- und Premierministerposten ist es eigentlich hier statt in derlei Superlativkampagnen, daß wir die Zukunft des ‚normalen‘ Politikbetriebs zu sehen bekommen werden. Da sich NRW für Rüttgers dabei als insgesamt wenig innovativ herausgestellt hat, wird es daher wohl noch eine Weile dauern, bis klar wird, wieweit soziale Medien auch von bereits existierenden Amtsinhabern effektiv genutzt werden können, um ihre Mehrheiten zu halten oder sogar auszubauen.
——
Dr. Axel Bruns (@snurb_dot_info) ist Associate Professor in der Creative-Industries-Fakultät an der Queensland University of Technology in Brisbane, Australia, und ein Chief Investigator im ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation (CCi). Er ist ein Experte für soziale Medien und Onlinejournalismus, und Autor der Bücher Blogs, Wikipedia, Second Life and Beyond: From Production to Produsage (2008) und Gatewatching: Collaborative Online News Production (2005), und Herausgeber von Uses of Blogs, mit Joanne Jacobs (2006; alle bei Peter Lang, New York). Seine Webseite ist snurb.info, und er bloggt auch im Gruppenblog Gatewatching.org, mit Jason Wilson und Barry Saunders.